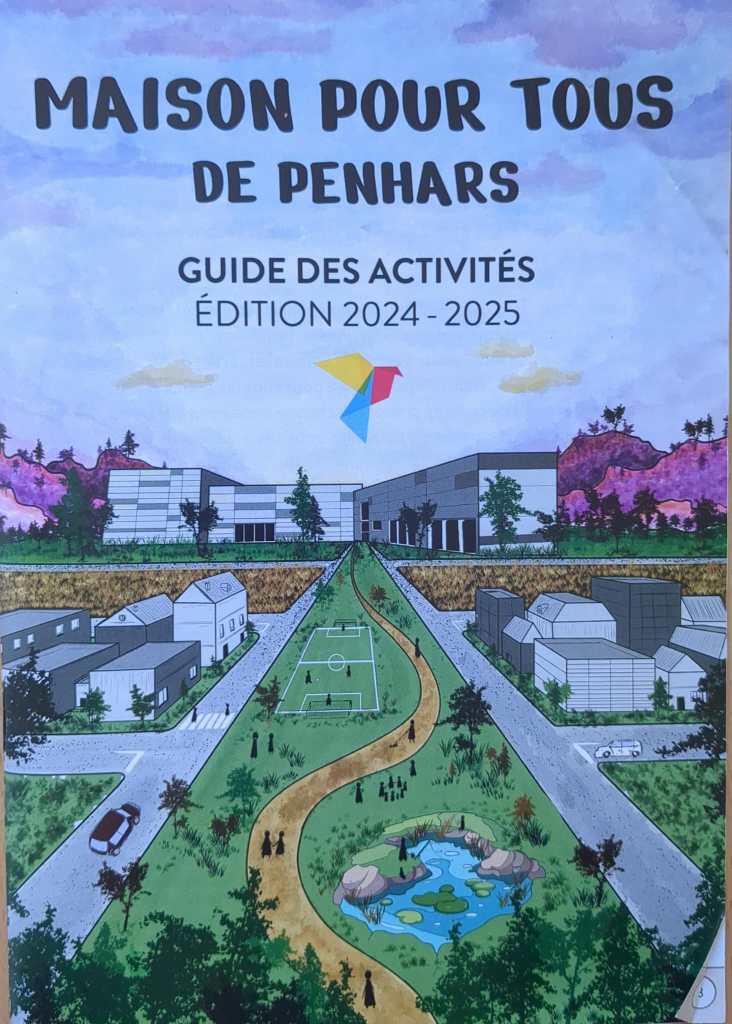Wie kleine Fischer in der Normandie für das Meer kämpfen und gegen das System verlieren
Franck Lemonnier steht an der Kaimauer im Hafen von Granville. Mit seinem Dackel Otto unterm Arm wartet er eine Welle ab, die sein Boot einige Meter hoch an den Rand des Kais hebt, um mit einem großen Schritt auf die Planke seines Kutters zu steigen. Sein von Alter und Sonne gezeichnetes Gesicht mit dem wilden, weißen Bart erzählt von einem Leben auf See, vom Meer, von den Wellen und dem Wind.
Auf dem Boot wartet seine Crew schon auf ihn. Laurent, sein Steuermann, wäre eigentlich schon in Pension. Sein eigenes Fischerboot hat er vor einem Jahr verkauft. Doch ihm fehlte das Meer, der Geruch nach Salz und Fisch, die Wellen unter seinen Füßen.
Wäre Franck eine Photographie, wäre Laurent sein Negativ. Alles an Laurent strahlt Lässigkeit aus. Seine blonden Haare wirken in der Sonne noch heller, das Tattoo auf seinem Unterarm grüßt auf balinesisch, seine Wasserhose sitzt locker auf seinem dünnen Körper. Er ist ein Lebemann, nimmt das Leben lockerer als Franck.
Vielleicht war Franck einmal wie Laurent, als er jung war. Frei und sorglos. Doch wenn, dann ist das schon Jahre her. Denn seit Jahren kämpft Franck. Er kämpft fürs Überleben seines Handwerks, für Selbstbestimmung im Job, für Gerechtigkeit und Mitsprache und gegen alle Vorurteile, mit denen er tagtäglich konfrontiert wird. Er kämpft gegen Bestimmungen und Regelungen, die sein Handwerk langsam und leise zerstören.
Wie die Fischer zu Umweltschützern wurden
Sie beide blicken auf ein Leben auf dem Meer zurück. Doch die Fischerei von früher, die gibt es nicht mehr, sagen sie.
„Was nur wenige wissen, ist, dass es anfangs kaum Vorgaben in der Fischerei gab. Wir waren es, die sie eingeführt haben“, erzählt Laurent. Vor über 30 Jahren, als Franck und Laurent mit der Fischerei begannen, handelte jeder Fischer nach seinen eigenen Regeln. Jeder hat gefischt, was er wollte und wo er wollte. Schnell erkannten sie, dass das nicht funktionieren konnte. „Wir mussten uns bewusst machen, dass die Tiere, die wir fangen, nicht unendlich sind. Und dass, wenn wir wollen, dass es so bleibt, wir uns anstrengen müssen. Wir arbeiten in einer kleinen Bucht, und die müssen wir schützen. Wir können nicht einfach woanders hin.“
Also fingen sie an, sich zu informieren. Sie holten sich Rat bei Wissenschaftlern des IFREMER-Instituts, ein französisches Forschungsinstitut, das Meeresarten untersucht und Daten für den Schutz der Ozeane sammelt. Auf Bitte kamen die Wissenschaftler mehrmals im Jahr mit auf ihre Boote, um die Bestände in ihrer Bucht zu vermessen. Aufgrund dieser Ergebnisse passten die Fischer ihre Praktiken an. So entstanden nach und nach Lizenzen, Schonzeiten und Fangbeschränkungen – alles aus eigener Initiative.
„Die anderen Fischer zu überzeugen, war nicht leicht“, erinnert sich Laurent. „Wir mussten hart kämpfen, um sie zur Vernunft zu bringen.“
„Die ersten Regulierer, die ersten Umweltschützer in der Region, das sind wir. Wir haben nicht darauf gewartet, dass Leute zu uns kommen und uns sagen, dass es falsch ist, was wir tun. Deshalb sind wir immer noch hier. Wir tun alles, um die Fischerei so verantwortungsvoll und nachhaltig wie möglich zu gestalten.“

Plötzlich wollen alle mitreden
Doch mit den Jahren kommen immer mehr Regelungen von außen hinzu. Und die neuen Regeln, die heute über die Fischerei in der Normandie entscheiden, kommen meist aus fernen Büros – aus Paris, aus Brüssel, aus Behörden, die mit Akten und Statistiken arbeiten, aber kaum mit Fischern sprechen. Unter dem Schlagwort „Naturschutz“ wird eine wachsende Zahl von Vorschriften erlassen: Fangquoten, Sperrzonen, Vorgaben für Netze und Geräte. Also all das, was die Fischer schon seit Jahren selbst und auf ihre Weise regelten.
„Jetzt ist hier ist absolut alles reglementiert“, meint Franck frustriert. „Alles, was du vor deinen Augen siehst, der Abstand und die Größe der Stege, die Größe der Boote, die Arbeiter*innen darauf, die Größe der Kisten, alles. Die Anzahl der Fanggeräte, die herumliegen dürfen, ist reglementiert, die Stunden sind reglementiert, die Tage sind reglementiert, es gibt biologische Schonzeiten.“ Er seufzt auf und setzt sich auf eine der Kisten. Franck sagt, er fühlt sich nicht mehr in einer Demokratie. „In einer Demokratie sagst du was und dann sage ich was. Aber hier wird nur mehr von oben herab bestimmt.“
Dabei ist den Fischern der Schutz des Meeres ein echtes Anliegen – nicht, weil es vorgeschrieben ist, sondern weil sie wissen, dass ihre Zukunft davon abhängt. Doch Naturschutz, der nur auf dem Papier entsteht, ohne die Fischer einzubeziehen, läuft aus ihrer Sicht ins Leere.
Für die kleinen handwerklichen Fischer fühlt sich das an wie ein starres Korsett, das immer enger gezogen wird. Denn all diese neuen Regeln sind für die Fischer nicht nur eine Frage von wirtschaftlicher Existenz, sondern auch von Respekt. Ihr Wissen über Strömungen, Bestände und ökologische Zusammenhänge wird kaum noch beachtet. Und die Vorschriften werden teuer. Die alten Boote entsprechen nicht mehr den Bestimmungen und müssten erneuert werden. Die kleinen Trawler, mit denen sie Muscheln am sandigen Meeresgrund sammelten, werden verboten. Die Kosten steigen, doch die Einnahmen sinken kontinuierlich. Mit seinen knapp 1200€ pro Monat kann sich Franck kaum über Wasser halten. Regeln werden über ihre Köpfe hinweg entschieden. Sie sollen Vorschriften befolgen, die vor Ort oft wenig Sinn ergeben oder hinderlich sind. Wenn sie nachfragen, werden sie weiterverwiesen oder vertröstet.

Das Ding mit den Rochen
Laurent kann sich an ein konkretes Beispiel erinnern. Eine EU-Kommissarin stellte in Norwegen fest, dass der Braunrochen dort vom Aussterben bedroht war. Also beschloss sie durch ihr Komitee, die Fischerei auf den Braunrochen in ganz Europa zu verbieten. Das Ding war nur: In der Normandie gab und gibt es immer noch viele Braunrochen.
Also holten die Fischer dort Wissenschaftler an Bord ihrer Boote. Sie wollten sie sehen lassen, dass die Bestände der Braunrochen hier immer noch sehr hoch sind. „Und dass unsere braunen Rochen auf keinen Fall die Rochen in Norwegen wiederbevölkern werden“, meint Laurent. Es dauerte fünf Jahre eines jährlichen wissenschaftlichen Ausschusses, dessen Ergebnisse positiv waren, um den Fang von Braunrochen wieder zu genehmigen und mit einer Fangquote von 100 Kilo pro Woche wieder zu eröffnen. In all dieser Zeit jedoch kämpften viele Fischer, besonders die, die sich aufs Fischen von Braunrochen spezialisiert hatten, um ihr finanzielles Überleben. Dieses Beispiel zeigt, wie wichtig es ist, bei Beschlüssen dieser Art die Fischer vor Ort miteinzubeziehen.
Doch die neuen Gesetze stoßen noch auf ein anderes Problem: In den Regelwerken wird oft kein Unterschied gemacht zwischen der handwerklichen Fischerei, die seit Generationen nachhaltig wirtschaftet, und der industriellen Fischerei, die mit riesigen Trawlern ganze Bestände in wenigen Tagen leerräumt. Diese Gleichbehandlung empfinden viele Fischer als fundamentale Ungerechtigkeit. Wer mit einem kleinen Boot und einfachen Netzen arbeitet, wird an denselben Maßstäben gemessen wie Konzerne, die in internationalen Gewässern fischen und kaum kontrollierbar sind. Und dies schürt die Vorurteile, mit denen die Fischer immer wieder konfrontiert werden, von Menschen, die diesen Unterschied nicht kennen. Franck schüttelt den Kopf: „Ich liebe meine Arbeit, aber sie wird mir echt schwer gemacht“.
Ein Beruf ohne Erben
Theoretisch könnte Franck in einem Jahr ebenfalls in Pension gehen. Aber dann müsste er sein Boot und seine Muschelfarmen verkaufen. Und das ist beinahe unmöglich geworden. „Niemand will mehr als Fischer arbeiten“, mein Frank, „die Arbeit ist zu ungewiss geworden.“ Er zeigt auf ein anderes Fischerboot, das gerade an ihm vorbeifährt. Grüßend reckt er die Hand zum Gruß. „Mein Kollege hier versucht sein Geschäft schon seit zwei Jahren zu verkaufen. Er findet einfach niemanden. Also macht er weiter.“
Das Durchschnittsalter der Fischer wird jedes Jahr höher, für junge Menschen ist der Job kaum noch attraktiv. Franck meint, dass die traditionelle Fischerei mit ihnen aussterben wird. „Das wäre eine Katastrophe für die Umwelt. Denn die kleinen, handwerklichen Fischer werden zunehmend von den großen, industriellen Booten ersetzt. Und diese kümmern sich nicht um die Umwelt“.
Ökologie und Umweltschutz sind ein Modewort geworden, meint Laurent. Seit ein paar Jahren wollen plötzlich alle mitreden, die Verbände, die Bürokraten und die Umweltschützer. „Sie wollen uns vorschreiben, wie wir unser Meer und die Lebewesen darin am besten schützen sollen. Doch Umweltschutz haben wir schon lange vor ihnen gemacht, und viel besser als sie, und zwar mit Wissenschaftlern. Also eigentlich muss man uns diese berühmte Ökologie des Umweltschutzes nicht beibringen. Wir sind damit im Einklang.“